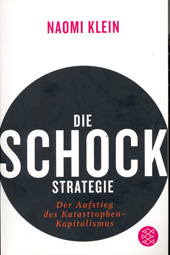Das dumme Wort „anti-amerikanisch“ hat jetzt, da Snowden die Machenschaften des NSA enttarnt hat, erneut Konjunktur. Und die, die schon immer dagegen antraten – haben Atemprobleme. Dabei wurde die Formel bewusst geboren, um den Spieß umzudrehen, sprich: die Verächter ans Kreuz zu schlagen. Ich erinnere mich gut an die Frage, die Allensbach vor zwanzig Jahren in die Menge warf: „Lieben Sie die Amerikaner?“ So platt kann Meinungsforschung im Grunde nicht agieren, schon gar nicht mit Noelle-Neumann an der Spitze – etwas infam hintergründig aber schon. Denn welche Antwort erwartete man: Ja oder Nein. Und wer schon will ein ganzes Volk verdammen?
Auch heute hält man wenig von Differenzierung. Die Amerikaner sind mächtig, gewiss: ab und zu auch aggressiv und widerlich … im Spionieren. Doch was soll’s? Die Anklage bedient für einen Augenblick die vordergründige Schlagzeile, sorgt für Auflage und Quote. Dann herrscht meist Ruhe.
Was ist diesmal passiert? Ein Mann, der vorgibt, sich bewusst eingeschleust zu haben, um aufzuklären, klärt auf. Er „entheimlicht“ den geheimsten der US-Geheimdienste und flieht dann. Zurück bleibt ein attraktives Trümmerfeld – ein Torso aus Erkundung und Impertinenz. Irische Banker werden entblößt, britische Geheimdienste als Oberschnüffler enttarnt und Deutschland aufs Netteste erniedrigt. Das, was die NSA aus Glasfasernetzen extrahierte oder einfach nur von kooperierenden IT-Firmen abforderte, scheint niederschmetternd. Da brandet für Momente Entsetzen auf. Da beginnt so etwas wie Hass, wenn sichtbar wird, dass auch EU-Institutionen und vor allem Deutschland im Fokus der Abschöpfung standen. Plötzlich glaubt man sich beraubt, weil der Datenklau natürlich auch das Kanzleramt, Finanzinstitute und Forschungseinrichtungen betreffen könnte, müsste, dürfte. Hier geht Wissen verloren, hier werden die Intrigen der Eurorettung observiert, hier hört man Banker verächtlich in den Äther husten. Nicht nur Amerika ist gegen uns, auch das weniger erfolgreiche Rest-Europa opponiert. Viel davon ist gespielt, manches macht hilflos – Heuchelei und Verdrängung bestimmen das Geschehen.
Haben wir nicht gewusst, dass die Amerikaner spionieren? Echelon gibt es sei mehr als 20 Jahren und Ami-Wanzen in deutschen Konzernen gehören zum Alltag. Ganz richtig: Eben das flackert immer mal auf, um ebenso schnell in Vergessenheit zu geraten. Es ist nun einmal so: Die amerikanische Regierung, die amerikanischen Geheimdienste machen, was sie wollen. Sie peitschen weltweit den Washington consensus (gezielter Freihandel + Protektionismus, Privatisierung und Austeritätspolitik) durch, betreiben die Abschöpfung von Informationen und Wissen (weil kostengünstiger als die Umsetzung eigener Kreativität), ballern Drohnen in fremde Länder, entziehen sich dem Internationalen Gerichtshof und nehmen politisch Einfluss – bei den wirtschaftlich Unterworfenen. Wenn Frau Merkel punktuell aufschreit, wenn EU-Beamte jetzt die Aufkündigung des gerade anverhandelten Freihandelsabkommens USA-EU androhen, dann geschieht das ausschließlich deshalb, weil die Bürger eine solche Reaktion erwarten, oder anders herum: weil das Ausbleiben einer solchen zu eklatanten Verlusten im Wahlkampf führen müsste. Inzwischen ist man dem sanften Druck der potentiellen Profiteure gewichen: Es bleibt beim Abkommen, flankiert von Datenschützern. Wer sich jetzt nicht totlacht, ist selber Schuld.
Doch das Ganze dreht sich noch weiter: Plötzlich wird der liebe BND NSA-ähnlicher Spionage bezichtigt. Auch er habe die Datenkabel fremder Botschaften angezapft – freilich nicht im US-amerikanischen Ausmaß und nur bei Onkel Karsai. Gleichwie: Die Relativierung der Ungeheuerlichkeit ist in vollem Gange. So wie man Echelon schluckte, soll man schon ab morgen auch die Lauschangriffe der NSA wegstecken. Denn was hilft es schon, wenn Deutschland und die EU die Proteste verschärfen, oder gar auf detaillierte Aufklärung drängen? Bekommt man dann die eigenen Intrigen und Schlafzimmergeschichten serviert, erfährt man dann Unliebsamkeiten, die man wiederum vor Lauschangriffen – vor neuen Wistleblowers, den Medien und damit der breiten Öffentlichkeit – verbergen muss?
Es ist lächerlich, und doch wird es aufgeführt. Man übt sich erneut im Kotau. Man schickt sich an, den Beteuerungen Obamas zu glauben. Er nämlich verspricht, es zu richten. Er verspricht, das neue Gleichgewicht herzustellen – das zwischen dem Anti-Terrorkampf und dem, was natürlich sein muss: der herkömmlicher Spionage. Welch ein Unsinn: Top-Terroristen bewegen sich außerhalb der Netze, und herkömmliche Spionage führt seit jeher ein Eigenleben. Wir sollten uns also straff darauf einstellen, dass die Schnüffelei weiter geht – künftig mit noch ausgefeilteren Techniken und Sicherheitsstandards. Daran werden auch Merkels Telefonate und Blitzbesuche im Weißen Haus nichts ändern. Gut, dass der Datenklau noch immer der Menschen bedarf, und es folglich Leute wie Snowden immer geben wird, Menschen, denen das Gewissen schlägt. Dieser Wettlauf zwischen Spionage und Enttarnung bleibt bis auf weiteres unsere Hoffnung. Was dennoch ausbleibt, ist die gelebte Solidarität – das bewusste Schützen derer, die uns aufklären. Dass viele von uns Snowden und Co. sofort Asyl gewähren würden, zählt nicht in dieser Welt. Hier entscheiden Regierungen – zumeist in gewohnter Feigheit, respektive: falscher „Aliiertheit“. So hat es nun auch die Bundesregierung abgelehnt, Snowden in Deutschland aufzunehmen – obwohl sie mehr als andere von den offen gelegten Daten profitiert hat. Man sagt NEIN und geht zum Tagesgeschäft über. Ob unser Protest daran etwas zu ändern vermag, steht in den Sternen.
Ähnlich reagieren bislang auch alle anderen Länder, bei denen Snowden um Asyl nachsuchte. Sie alle fürchten Verprellungen und Restriktionen – im und aus dem Land der Täter. Ein aus taktischer Sicht verständlicher Vorgang, könnte man meinen. Eine jämmerliche Schande, muss man schlussfolgern – vor allem für die sogenannten Demokratien. Diese Schande allerdings passt gut ins westliche Establishment, das Transparenz und arabische Frühlinge lautstark und fortwährend zu beheucheln vermag.
Was wird aus Aufklärern wie Julian Assange, Manning Bradley und Edward Snowden?
Jeder von uns sollte sich die Frage strikt stellen. Müssen wir hinnehmen, dass sie ein Leben lang vaterlandslos umherirren oder irgendwann gefasst, ausgeliefert, eingekerkert oder gar zum Tode verurteilt werden? Welche Reichweite hat unser Wille? Dürfen wir geschehen lassen, was nicht geschehen darf? Müssen wir nicht die große Petition, die Welt umfassende Freisprechung, wenn nicht gar die höchste Würdigung in Gang setzen? Sind nicht wir – die Bürger – in der Sache gefragt, wo doch die Politik so kläglich versagt?
Die USA werden eine Zeit lang am NSA-Gate zu knacken haben. Wirklich gefährden wird sie auch das nicht. Denn der Skandal löst – wie jede Krise – neue wirtschaftsrelevante Entwicklungen aus, und die Ablehnung von Seiten der Belauschten wird auch künftig nicht weh tun. Denn man bleibt (zumindest vorerst) Sieger, solange man Netz, Wirtschaftsimperien und Finanzmärkte am eigenen Ufer weiß. Die EU aber wird immer stärker physisch und mental verletzt werden. Hinzu kommt die Furcht, dass US-amerikanische Rating-Agenturen gezielte Infos der NSA nutzen, um Europa weiter gen Hörigkeit oder Abgrund zu treiben. Was bei Fiskalpakt und ESM im Geheimen lief, dürfte als Weggeber offen liegen.
Irgendwie passt es nicht hierher. Und doch ist es Teil des Gesamtspiels. Obama ist derzeit bemüht, das ramponierte Image der USA irgendwie aufzupolieren. Ein Besuch in Südafrika schien geeignet. Befördert durch die emotional bestimmte „Hautfarbe-Identität“ geisterte der amerikanische Präsident durch die Gefängniszellen von Robben Island. Ein Glück für ihn, mehr aber noch für den todkranken Mandela, dass sich beide verfehlten – und die zwanghafte Heuchelei ausblieb. Obama nämlich – der schamlose Image-Absauger – hat bei Mandela nichts, und auch gar nichts zu suchen. US-Präsidenten haben das Apartheidregime stets toleriert – sie täten es heute erneut. Nur Erzfeind Castro hat den ANC gegen Botha und Co. unterstützt – mit Menschenopfern und Waffen.
Auf meiner Wandtafel hängt ein Bild. Es zeigt Mandela und Castro. Sie gehen auf einander zu, breiten ihre Arme aus, um sich … in den Armen zu liegen. Mandela ruft: Fidel, Fidel, Fidel …!